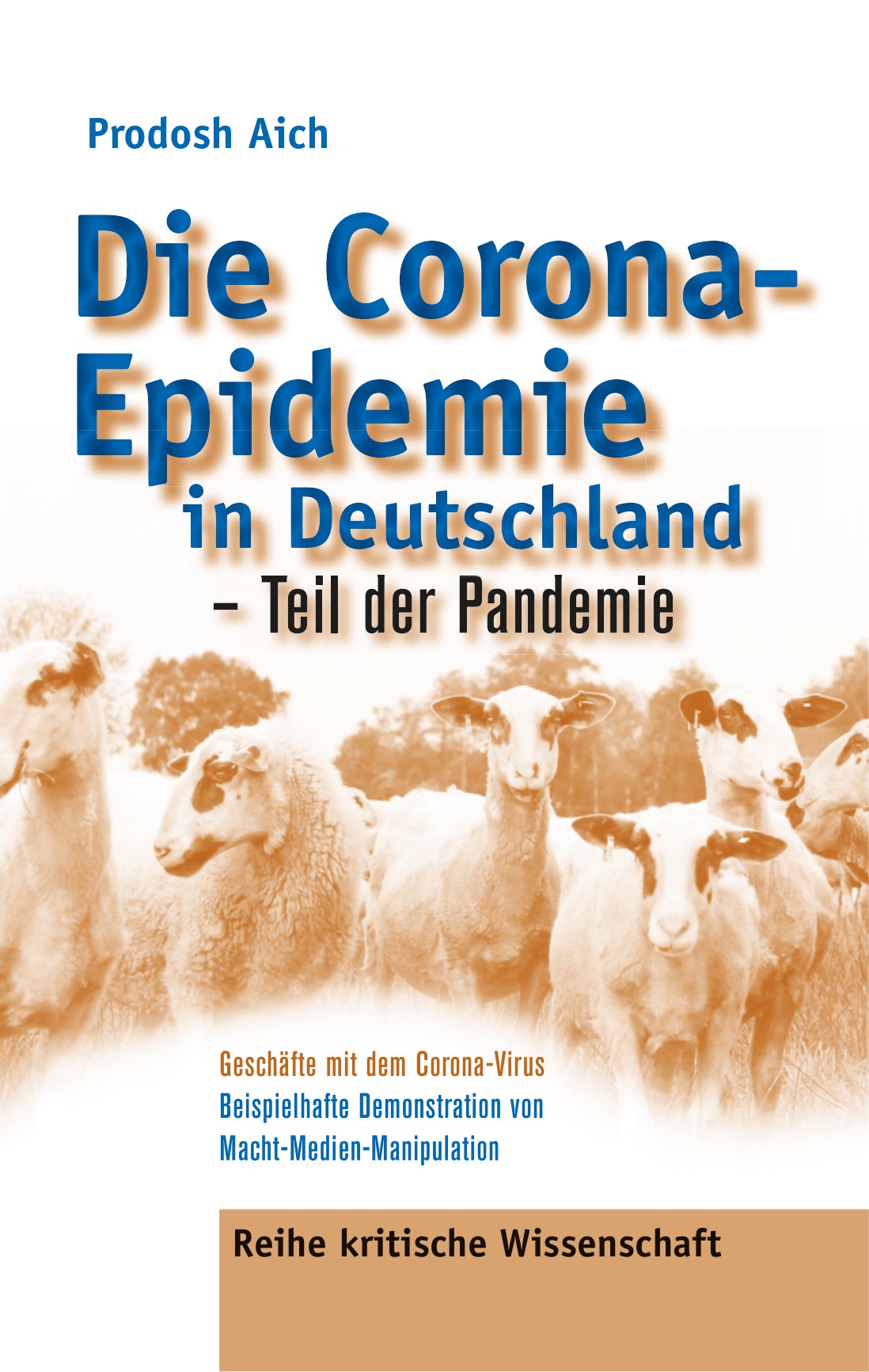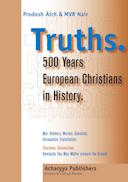Preis des aufrechten Gangs
Eine dokumentarische Erzählung von Prodosh Ai
Zu diesem Buch
Politische und moralische Sittengeschichten in der Bundesrepublik Deutschland und Indien zwischen 1957 und 1987, exemplarisch dokumentiert an einer zusammenhängenden Geschichte. Protagonisten sind: Wissenschaftler, Politiker, Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Publizisten, Medienvertreter, Wissenschaftsbetriebe, Ministerien, Medien und Gerichte.
Die Geschichte ermöglicht Einblicke in die Verhältnisse der deutschen und der indischen Gesellschaft, in die moralische Befindlichkeit der Elite, und in die Art und Weise des Wissenschaftbetreibens und vieles mehr. Aspekte, die in beiden Ländern noch nicht thematisiert sind.
Inhaltsverzeichnis, Die Einleitung: Der unerwartete Anstoß und die Rückseite des Umschlags folgen.
Inhaltsverzeichnis
Ein unerwarteter Anstoß 7
Prolog 12
Der Kulturschock? 52
Die „Indische Universität“ nimmt Gestalt an 90
Der Fragebogen 105
Die verborgenen Gesichter einer Universität 121
Jaipur ist auch anderswo,
und Mathurs sind überall 140
Die „unklaren Verhältnisse“
beginnen sich aufzuklären 164
Eine „orientalische“ Überraschung
in einem undurchsichtigen Stellvertreterkrieg 183
Und wie mahlen die Mühlen des „Okzidents“? 211
Zeit zum Auftanken, Zeit zum Nachdenken 234
Ein Alptraum in Köln 245
Über die Befindlichkeit
der deutschen Elite und von ihrer Moral 281
Kleine Unwägbarkeiten des Lebens 352
Von der Moral der deutschen Gerichtsbarkeit 377
Die „Indische Universität“ in der Geschichte 416
Worauf die uneingeschränkte Despotie
deutscher Professoren ruht 473
Wer sind die Studierenden in Indien? 492
Das ist, was die indische Universität produziert 517
Im Zeichen „Chinatowns“ 558
Epilog 648
Ein unerwarteter Anstoß
Vor kurzem begegne ich einem Kopten aus Ägypten, wie ich in Deutschland und auch Gesellschaftswissenschaftler. Er hat Lehrverbot in Deutschland, weil er als Nichtmuslim die arabisch erzählte Geschichte über Palästina für wahrheitsnäher hält als die zionistisch erzählte. Karam Khella heißt er. Ich finde ihn sympathisch. Wir tauschen Meinungen, Erfahrungen aus. Eher beiläufig erwähne ich, daß einem Verfasser nicht seine veröffentlichten Bücher wirkliche Erkenntnisse über die moralische Befindlichkeit, den Standort einer Gesellschaft bringen, sondern seine unterdrückten Bücher, die Art und Weise ihrer Unterdrückung, die Skrupellosigkeit der im öffentlichen Leben stehenden Akteure, ihre Verlogenheit, ihre doppelte Moral, der zunehmende Verfall der Werte bei ihnen. Ich habe, erzähle ich ihm, zwei solche Bücher. Und: Stelle dir vor, sage ich ihm, nicht nur der Inhalt der unterdrückten Manuskripte ist nach wie vor aktuell. Aktueller denn je ist das Drum und Dran der Geschichten, vor allem, wie sie unterdrückt wurden. Und die Verhältnisse haben sich wesentlich verschlechtert. Aber wen interessieren solche Geschichten?
Da fragt mich dieser „verrückte“ Kopte aus Ägypten unvermittelt, ob ich wisse, wie viele Menschen in Deutschland leben, die keine Deutschen sind? „Weißt du“, setzt er nach, „daß diese Menschen deutsch sprechen und deutsch lesen, wie du und ich? Diese Menschen haben einen Anspruch darauf, daß du diese Geschichten der Unterdrückung, die auch ein subtiler Ausdruck des Rassismus sind, erzählst. Die deutschsprachige Literatur, die deutsche Sprache kann, darf nicht den Deutschen allein überlassen bleiben. Und diese Menschen werden immer mehr. Sie haben einen Anspruch darauf, daß du Geschichten wie diese erzählst. Damit sie in diesem Land ihre Standorte bestimmen lernen.“
Ja, Karam Khella hat mich nachdenklich gemacht. Ich lebe in Deutschland länger als die meisten Deutschen. Aufgewachsen bin ich in einer anderen Kultur. Nichts war mir in Deutschland selbstverständlich und vertraut. Vom ersten Tag an hatte ich eine kulturelle Distanz zu den hiesigen Verhältnissen. Trotzdem, oder gerade deshalb, habe ich mich hier nicht wenig eingemischt. Jede mich unmittelbar betreffende Ungereimtheit hat mich zum Widerspruch provoziert, nach dem Motto: nicht mit mir. Ungereimtheiten, die die meisten Deutschen widerspruchslos schlucken oder aber nicht einmal wahrnehmen. Die unvermeidliche Folge dieser meiner Haltung sind große und kleine Konflikte gewesen. Nicht zwischenmenschliche Unstimmigkeiten. Nein. Konflikte mit Institutionen bzw. mit einzelnen Vertretern der Institutionen. Je höher ihre Stellung innerhalb der Hackordnung ist, um so weniger scheinen sie sich um die verfaßten Werte ihrer eigenen Institutionen zu scheren. Die Deutschen nehmen diesen Tatbestand ohne sichtbaren Widerspruch hin. Aus der Erfahrung des Alltags heraus: „Die da oben sitzen eh am längeren Hebel.“ Ich hatte keine Gelegenheit, solche Alltagserfahrungen zu verinnerlichen. Mein Erfahrungsschatz ist angefüllt mit Konflikten. Mein Erfahrungsschatz ist ein anderer und reicherer. Und dokumentierbar.
Es ist unfaßbar, wozu viele Vertreter demokratisch verfaßter Institutionen fähig sind, zu welchen Tiefen sie sinken können, wenn sie in die Ecke geraten, wenn ihnen die Argumente ausgehen. Dann vergessen sie das öffentlich geraspelte Süßholz und die gedroschenen Phrasen. Soll ich diesen Erfahrungsreichtum mit ins Grab nehmen? Darf ich es? Ich habe in diesem Land 45 Jahre gelebt. Entsteht daraus die Verpflichtung, so frage ich mich, meinen Erfahrungsschatz zumindest als Baustein für die bitter notwendige Sozialgeschichte anzubieten?
Also blättere ich in den Unterlagen meiner ersten unterdrückten Forschungsarbeit, die einige Umzüge überstanden haben. Sie elektrisieren mich. Wie habe ich diese Geschichte so lange und so gründlich verdrängen können? Ja, dieser Karam Khella! Ich erkenne, daß die ganzen Geschichten eher noch aktueller geworden sind.
Ob auch der öffentlich häufig geleugnete Rassismus bei den vielen meiner Auseinandersetzungen und bei der Unterdrückung zweier meiner Bücher eine Rolle gespielt hat, ist zweitrangig. Klar, es fällt den Angehörigen der „blond-blauäugig-weiß-christlichen“ Kultur (Erläuterungen dazu folgen im „Prolog“) schwer, damit zu leben, daß auch andere denken können, daß andere Menschen Kulturen hervorgebracht haben, denen die kompromißlose Ausbeutung, die Unterdrückung, die Entwürdigung anderer und der Völkermord nicht eingefallen sind. Daß es Angehörige solcher Kulturen nun im Zentrum ihres Machtbereiches in vielen Bereichen ihnen gleich tun, sie auch überragen, ist schwer verdaulich. Mag alles sein. Aber fällt die Art und Weise der Unterdrückung der eigenen Leuten anders aus?
Also habe ich mich überzeugen lassen, die Geschichten meines ersten unterdrückten Buches zu erzählen. Sie spielen sich in und um Universitäten ab, sind diese doch wichtige Facetten der Sozialgeschichte schlechthin. Denn die Universität ist eine prägende gesellschaftliche Einrichtung. Überall.
Sozialgeschichten werden selten erzählt. Solche über Universitäten noch nie. Wer verfügt schon über das belegbare Wissen, um Geschichten aus Universitäten zu erzählen? Auch systematisches Sammeln von nicht mehr belegbaren kleineren Geschichten wären wichtig. Aber wer soll sie sammeln, wer soll sie aufschreiben? Ist es für die Karriere förderlich, solche Geschichten zu veröffentlichen?
Sozialgeschichten sind Geschichten über soziale Konflikte. Nun gibt es in allen Konflikten Sieger und Besiegte, Gewinner und Verlierer. Die Gewinner und Sieger ziehen es eher vor, über die wirklich angewandten Mittel zu schweigen. Was zählt, ist der Sieg. Sieger verdienen eben den Sieg. Heldenhaft, versteht sich. Und wer soll sich für die Geschichte des Verlierers interessieren? Deshalb werden so selten Sozialgeschichten geschrieben.
Eine kleine, kurzgefaßte, aber doch beispielhafte Episode soll verdeutlichen, was damit gemeint ist. Schauplatz ist die Universität Köln. Mitte der fünfziger Jahre. Noch gibt es keine Massenuniversitäten. Der Grad der Anonymität ist gering. Hans Albert ist noch nicht bekannt als ein hervorragender SoziaIwissenschaftler. Er habilitiert sich gerade in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät. Seine Habilitation hängt an einem seidenen Faden. Nicht weil seine Arbeit dem wissenschaftlichen Anspruch nicht genügt hätte. Nein. Sein wissenschaftstheoretischer Teil ist zu gut, wie später der in der „Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie“ ausdauernd geführte wissenschaftstheoretische Disput über den „Positivismus“ mit Jürgen Habermas zeigen wird. Dieser methodologische Teil stellt die gängige gesellschaftswissenschaftlche Praxis in Frage, implizit auch jene bestallten Fakultätsmitglieder.
So ist halt die Wissenschaft in der Geschichte, auch wenn dies vielen etablierten Wissenschaftlern so häufig gegen den Strich geht. Die geltenden Erkenntnisse werden immer wieder auf den Prüfstand gebracht, neue Aspekte kommen hinzu, die Wissenschaft entwickelt sich, und das Wissen wächst. So sollte es sein. Aus der Natur der Sache heraus. So wäre es auch immer, wenn die Wissenschaftler nur Wissenschaftler wären. Aber sie sind auch Menschen und zuweilen allzu menschlich. Wie beispielsweise jene Mitglieder der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Köln. Ordinarien. Mitte der fünfziger Jahre. Sie haben die Macht, die Habilitationsarbeit von Hans Albert abzulehnen, auf Änderungen zu bestehen, ihn zum Widerruf zu zwingen, unabhängig von der wissenschaftlichen Qualität. Und sie sind entschlossen, gegen Hans Albert ihre Macht zu mißbrauchen.
Fakultätsintern, vielleicht auch universitätsintern, wird über den Vorfall getuschelt. Wäre da nicht ein Fakultätsmitglied namens Gerhard Weisser gewesen, der von der Politik als Sozialpolitiker in die Wissenschaft gekommen war, hätte Hans Albert wahrscheinlich wider seines Gewissen große Zugeständnisse machen müssen. Er hätte keine andere Wahl gehabt, wollte er weiterhin im Wissenschaftsbetrieb arbeiten. Und: Er hat bis dahin kein anderes Handwerk als „Wissenschaft“ gelernt. Auch Gerhard Weisser gelingt es nicht, die Arbeit ohne Zugeständnisse durchzubringen.
Nach der erfolgten Habilitation hätte Hans Albert diesen eines Wissenschaftsbetriebs unwürdigen Vorfall öffentlich machen können. Nur, das wäre dann auch das Ende seiner wissenschaftlichen Karriere gewesen. Höchstwahrscheinlich. Später kann er die Geschichte auch nicht erzählen, weil „Wohlverhalten“ für das Weiterkommen im Wissenschaftsbetrieb wichtig ist. Dieser Wirkzusammenhang stellt sicher, daß sich Ähnliches in der Universität Köln und auch anderswo wiederholte.
Ich habe einfach Glück gehabt, daß ich ohne faule Kompromisse dem Universitätsbetrieb erhalten geblieben bin. Aber erzählt habe ich die Geschichten auch nicht. Noch nicht. Schon immer mal habe ich mir durch den Kopf gehen lassen, ob es nicht meine Verpflichtung wäre, die Geschichten zu erzählen. Aber dann holt einen der Alltag wieder ein. Und Entschuldigungen wie: „Sei doch froh und zufrieden, daß Du den Rücken nicht krumm machen mußtest, daß Du nicht ständig verlogen sein mußtest, daß Du Dich nicht auf die Couch oder aufs Krankenbett legen mußtest“. Bis ich mit einer verrückt erscheinenden Frage von Karam Khella konfrontiert werde.
Auch eine Universität entwickelt sich nicht von selbst. Sie wird entwickelt. Forscher, Lehrer, Studierende, Dienstleister aller Art und auf verschiedenen Ebenen entwickeln sie. Und jene einflußreichen Mitglieder der Gesellschaft, die die materielle Funktionsfähigkeit sicherstellen und aus dem Hintergrund die Drähte ziehen. Also fließen in die Universität vielfältige Interessen ein. Deshalb wird in den Universitäten nicht über alles geforscht, was gesellschaftlich notwendig wäre. Nein, geforscht wird nur in jenen Bereichen und über jene Themen, für die Forschungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Steckenpferde einzelner Forscher sind selten, noch seltener sind zufällige Entdeckungen.
Die Lehre richtet sich folgerichtig nach den so gewonnenen Forschungsergebnissen. Selbstverständlich wird auch nicht alles gelehrt, werden auch nicht alle verfügbaren Forschungsergebnisse zur Lehre herangezogen. Nein. Gelehrt werden nur jene Aspekte, mit denen sich die Forscher und Lehrer gerade beschäftigen und die mit dem geringsten Aufwand in die Lehre einzubringen sind. Regelmäßige Wiederholungen sind die Regel. Lehre bringt keinen Ruhm, das tun nur veröffentlichungsfähige Forschungsergebnisse. Und ohne Ruhm keine Karriere. Ohne Karriere kein Reichtum. Und es gibt auch Forschungsergebnisse, die noch wertvoller sind, wenn sie nicht veröffentlicht werden, wenn sie unter Verschluß gehalten werden. Marktgesetze! Auch deshalb hat Forschung Vorrang. Und Forschung kostet Zeit. Viel Zeit.
Dieser Lauf der Dinge pflanzt sich fort. Studierende sind die schwächsten Akteure auf dieser Bühne, schwächer gar als die Dienstleister in den Universitäten. Ihr Anpassungsdruck ist groß. Nischen sind selten. Sie lernen mehr als sie fragen. Kritische Fragen sind weder bei den Lehrenden noch bei den Kommilitonen gern gesehen. Sie entsprängen Profilierungssüchten, heißt es. Sie seien zeittötend. Seltenst haben Studierende Gelegenheit, Einblicke in die Verteilung und Verflechtung der Macht innerhalb der Universität zu gewinnen, über die Handlungen der wirklichen Drahtzieher Bescheid zu wissen. Sie haben nicht einmal die faktische Möglichkeit, ihre Lehrer insoweit zu kennen, daß sie wissen, wie und warum ihre Lehrer zu ihren Forschungsschwerpunkten gekommen sind. Später, mit zunehmenden Alter, sind sie dann selbst in jenen leitenden gesellschaftlichen Funktionen tätig, über die sie sich in ihrer Lernzeit keine Einblicke, keine Durchblicke verschaffen konnten.
Ich weiß, daß es zu dem bisher Gesagten kaum Widerspruch geben wird. Auf dieser allgemeinen Ebene sind diese Worte selbstverständlich und deshalb hätte auf sie eigentlich auch verzichtet werden können. Aber nicht in meiner dokumentarischen Erzählung, wie ich meine. Sie benötigt einen gemeinsamen Merkposten, so etwas wie eine Meßlatte.
Ich bin geboren in Kalkutta, indischer Staatsangehöriger nach wie vor, auf Lebenszeit beamteter Hochschullehrer in Deutschland. Der „Freiheit der Forschung und Lehre“ zum Trotz bin ich wiederholt von meinen wissenschaftlichen Schwerpunkten vertrieben worden. Das Wie und das Warum scheint System zu haben. In allen Universitäten geschieht ähnliches und gleiches. Aber das bleibt unerzählt.
Einige Zitate und Fakten mögen wie Wiederholungen erscheinen. Es sind eigentlich keine Wiederholungen, denn in dem jeweiligen Zusammen-hang erhalten sie unterschiedliches Gewicht und unterschiedliche Tragweiten. Eine persönliche Erklärung noch. Ich danke allen, wirklich allen, die – wie in dieser Geschichte erzählt – uns, mich zu Erkenntnissen von unschätzbarem Wert geführt haben. Den Text dieser Erzählung haben Klaus Schleuter, angehender Sozial-pädagoge, Rechtsanwalt Volker Felmy und meine Frau kritisch gelesen.
Die Rückseite des Umschlags
Fremdenfeindlichkeit in Deutschland hat tiefe Wurzeln. Hier ist ein Beispiel:
Die Deutschen Botschaft in Neu-Delhi schreibt am 6. Oktober 1967:
„Betr.: Aufenthaltserlaubnis, Bezug: Ihr Antrag vom 13. 7. 1967
Sehr geehrter Herr Dr. Aich, der Botschaft liegt ein Schreiben der Stadt Bonn vor, wonach Sie im Besitz einer bis zum 30. 09. 1967 gültigen Aufenthaltserlaubnis zur Arbeitsaufnahme sind. Ihrem Antrag auf Zusicherung der Aufenthaltserlaubnis ... hat die Stadt Bonn, der das Ersuchen der Botschaft vom 17. 07. 1967 auf Grund der Tatsache, daß Sie noch für Bonn, Weberstr. 96, gemeldet sind, übergeben worden war, nicht entsprochen. Die Botschaft bedauert, Ihnen keinen günstigeren Bescheid erteilen zu können. Mit vorzügli-cher Hochachtung, Im Auftrag, (Müller), Konsularsekretär 1. Klasse“
Mein Schreiben an Herrn Willy Brandt, Bundesminister des Auswärtigen vom 12. Dezember 1967:
„Sehr geehrter Herr Brandt, (...) Auf Anraten meines Anwaltes habe ich an die Ausländerbehörde Bonn einen Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung gestellt, dem auch sofort entsprochen wurde. Da eine frühere Ablehnung und jetzige Erteilung schwer zu vereinbaren wären, darf ich Sie bitten, freundlicherweise durch Ihr Amt nachprüfen zu lassen, ob die Ausländerbehörde in Bonn überhaupt jemals abgelehnt hatte. Für eine diesbezügliche Mitteilung wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar.“
Erst nach einer Mahnung z. Hd. des persönlichen Referenten Willy Brandts kommt eine längst fällige Stellungnahme. Schamloser hätte sie nicht ausfallen können. Sie trägt das Datum von 15. Februar 1968:
„Sehr geehrter Herr Dr. Aich, auf Ihr Schreiben vom 16. Januar 1968 kann ich Ihnen mitteilen, daß eine Prüfung der Angelegenheit ergeben hat, daß Ihnen die Deutsche Botschaft in New Delhi aufgrund eines Mißverständnisses die Aufenthaltserlaubnis in der Form eines Sichtvermerks versagt hat. Das Ausländeramt in Bonn hat die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis niemals abgelehnt. Mit vorzüglicher Hochachtung, Im Auftrag, gez. Dr. von Hassell, Beglaubigt“